Ist das ein Mensch? – Ein Blick in die Abgründe der Menschlichkeit
Erfahre wissenswertes Rund ums Buch Ist das ein Mensch von Primo Levi. Profitiere von interessanten Deutungsansätzen und einem komprehensiven Review.
Nils David Hürlimann
12/28/20247 min read
Ist das ein Mensch – Primo Levi (1947)
Es handelt sich um ein autobiografisches Werk, in dem Primo Levi seine Erlebnisse im Konzentrationslager Auschwitz schildert. Das Buch ist ein eindringliches Zeugnis über die Schrecken des Holocaust und thematisiert die Entmenschlichung, den Überlebenswillen und die moralischen Fragen, die sich in einer solchen Extremsituation stellen. Es gehört zu den wichtigsten literarischen Auseinandersetzungen mit dem Holocaust.
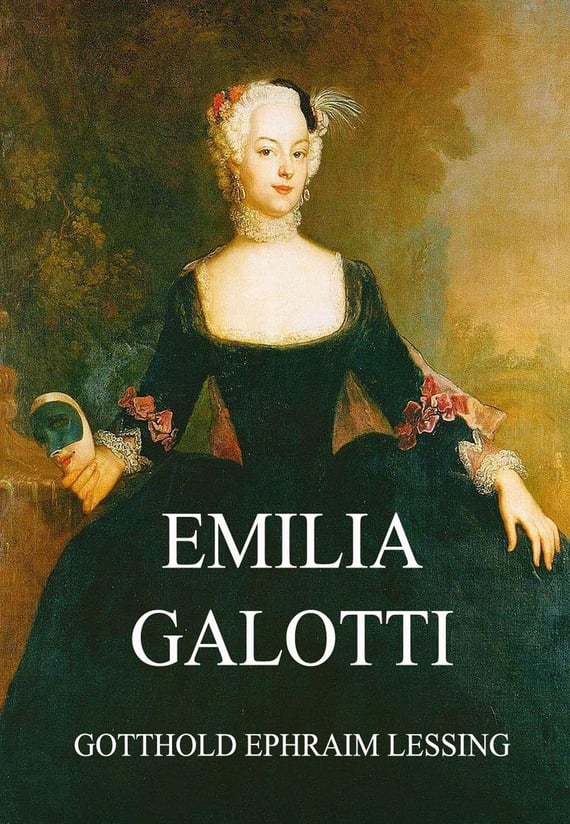
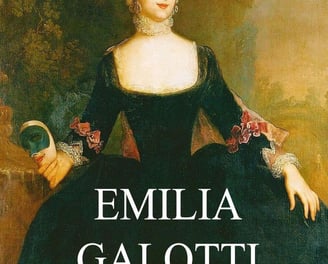
Alles auf einen Blick
Grundlegene Informationen
Ist das ein Mensch? war einer der ersten Berichte eines Holocaust-Überlebenden. Primo Levi versucht darin, eine Antwort auf die Frage zu finden, was den Menschen und die menschliche Seele ausmachen. Levi verfasste seinen Bericht in der ersten Person Singular aus dem dringenden Bedürfnis heraus, seine Erlebnisse in Auschwitz mit der Aussenwelt zu teilen.
Das Buch erschien im Jahr 1947 in einem kleinen Verlag und erfuhr in der direkten Nachkriegszeit nur einen mässigen Erfolg. Erst mit der Neuauflage im Jahr 1958 stieg das Interesse an Levis Werk, das weiterhin des Öfteren adaptiert wurde. Heute wird Ist das ein Mensch? als eines der Hauptwerke der Holocaust-Literatur angesehen.
Inhalt
Primo Levi, ein jüdischer Italiener, wird während des Zweiten Weltkriegs verhaftet und nach Auschwitz deportiert. Bei der Ankunft erfolgt eine Selektion: Kranke werden sofort getötet, Gesunde zur Arbeit gezwungen. Levi lernt schnell die brutalen Lagerregeln, verliert Hoffnung und erkennt die Seiten des Alltags.
Nach einer Fussverletzung verbringt Levi Zeit auf der Krankenstation, wo er über das Lager reflektiert. Später wird er dem Block 45 zugeteilt, wo Handeln überlebenswichtig ist. Zuerst arbeitet er körperlich schwer, bis er durch eine Chemieprüfung in ein Labor versetzt wird. Hier begegnet er Dr. Pannwitz, der ihn entmenschlicht betrachtet. Mit Jean, dem „Pikkolo“, schliesst Levi eine starke Freundschaft.
Der Alltag bleibt von Hunger, Kälte und Tod geprägt. Lorenzo, ein italienischer Zivilarbeiter, unterstützt Levi und erinnert ihn an seine Menschlichkeit. Während die Alliierten von Tag zu Tag näherkommen, verschlechtert sich die Lage weiter. Nach einer erneuten Selektion überlebt Levi dank seiner Versetzung ins Chemielabor.
Kurz vor der Befreiung erkrankt Levi an Scharlach und bleibt auf der Krankenstation zurück, während die meisten Gefangenen auf Todesmärsche geschickt werden und sterben. Mit Hilfe zweier Franzosen überlebt er, bis die russischen Truppen das Lager befreien. Levi bleibt fest davon überzeugt, dass das Lager die menschliche Seele tiefgreifend offenbart und die Trennung zwischen „Geretteten“ und „Verlorenen“ sichtbar macht.
Die Spannungskurve beginnt mit Primo Levis Ankunft in Auschwitz. Spannung steigt durch Momente extremer Gefahr und Reflexion (Krankenbau, Chemielabor, Selektionen) an, erreicht ihren Höhepunkt während der letzten Wochen im Lager und findet ihre Auflösung in der Befreiung durch die Rote Armee.
Figuren
Primo Levi:
Der Autor ist der Protagonist der Erzählung. Der gelernte Chemiker, damals 24-jährig, wird am 13. Dezember 1943 von den Faschisten festgenommen. Im Konzentrationslager sieht man ihn als Mann mit «zwei linken Händen» da Primo Levi kein Talent hat für handwerkliche Tätigkeiten. Er wird nach seiner Ankunft dem KZ Monowitz (verbunden mit Ausschwitz) zugewiesen.
Anfangs verhält sich Levi noch ehrlich und zuvorkommend. Jedoch bemerkt der Protagonist schnell, dass er sein Verhalten ändern muss, wenn er überleben will. Im KZ gibt es keinen Platz für Mitleid oder Freundlichkeit, nur eine gewisse Boshaftigkeit ermöglicht ein Überleben.
Durch seine Ausbildung als Chemiker darf Levi im Chemielabor des Konzentrationslagers arbeiten. Im Gegensatz zu den anderen Mitinsassen muss er nicht draussen arbeiten und schwere Dinge transportieren, dadurch fühlt er sicher weniger versklavt.
Anfangs 1945 erkrankt Levi jedoch an «Scharlach» und wird in die Krankenstation eingewiesen. Ein paar Tage später räumen die Soldaten jedoch das Konzentrationslager, sie lassen die Kranken zurück während der anderen Gefangenen zum Abmarsch gezwungen wurden. Die Rote Armee befreite das Konzentrationslager und Primo Levi war frei, er machte sich zurück auf den Weg in seine Heimat, Turin.
Alberto Dallavolta (Für Levi):
Er ist ein Helfer für Primo Levi. Der Italiener hat sich dem Konzentrationslager angepasst, er hat schnell verstanden, dass es viel Stärke braucht, um im KZ zu überleben. Mit Levi zusammen besorgt er Nahrung, was ihnen das Leben rettet. Bei der Räumung des Lagers wird Alberto von den Nazis abgeführt.
Lorenzo Perrone (Für Levi):
Lorenzo ist Zwangsarbeiter im Chemielabor. Er bekommt einen Lohn und hat an Sonntagen frei. Er wird als hilfsbereit charakterisiert und gibt Levi zusätzliche Nahrung, was ihm beim Überleben hilft. Er besucht Primo Levis Mutter in seiner Heimat in Turin, um ihr mitzuteilen, dass er noch am Leben ist.
Charles Conreau (Für Levi):
Charles Conreau ist ein französischer Gefangener. Er kam bei der Räumung ins Konzentrationslager und verbrachte noch die letzten Tage auf der Krankenstation bei Levi. Charles konnte geschickt den Raum heizen, bis schliesslich die rote Armee eintraf.
Pikkolo (Für Levi):
Jean Samuel wird Pikkolo genannt, da er der jüngste ist. Levi lernt den Chemiker Pikkolo im Chemielabor kennen. Er hilft Levi, indem er ihm Zeit verschaffen konnte, in der er nicht arbeiten musste. Wie als er abends mit ihm Suppen holen konnte.
Dr. Pannwitz (Gegen Levi):
Dr. Pannwitz ist bei der Sturmstaffel und ist bekannt für seinen starken Hass auf jüdische Gefangen. Er leitet das Chemielabor des Konzentrationslagers.
Die Grünen Dreiecke (Gegen Levi):
Die Grünen Dreiecke sind Deutsche, die für eine Straftat verurteilt wurden und ebenso ins Konzentrationslager geschickt wurden. Durch ihre Ethnie haben einen Vorteil gegenüber den anderen gefangenen.
Die Kapos (Gegen Levi):
Die Kapos stehen in der Hierarchie über allen anderen Gefangenen. Die SS wählt aus den Gefangenen die aus, mit besonderen Fähigkeiten. Under diesen werden die Kapos ausgewählt, die nun den anderen Häftlingen übergeordnet sind. Die Macht, die die Kapos dadurch erlangen wird oftmals ausgenutzt.
Form
Die Sprache von «Ist das ein Mensch?» von Primo Levi ist grösstenteils einfach und klar. Obwohl der Text ausgesprochen emotional ist, bleibt die Sprache direkt, präzise und sachlich. Jedoch gibt es teilweise auch etwas anspruchsvollere Passagen, bei denen Levi seine Gedanken zu Menschlichkeit ausformuliert und in die Philosophie abdriftet.
Primo Levi schildert seine Geschichte mit einer linearen Struktur, so dass es einen klaren zeitlichen Strang gibt. Die Geschichte wird aus der 1. Person Singular geschrieben, aus der Ich-Perspektive Levis.
Deutung
Themen und moralische Fragen
a) Das verlorene Zeitgefühl
Die Gefangenen verlieren jegliches Gefühl für Zeit. Der Alltag wird durch Arbeit und physische Qualen strukturiert, nicht durch Stunden und Tage.
Zeit wird zur endlosen Gegenwart, in der nur das Überleben von Moment zu Moment zählt.
b) Die Rolle der Sprache
Sprache dient im Lager als Werkzeug der Macht und Erniedrigung. Deutsch wird zur Sprache der Täter, während die Gefangenen oft nicht kommunizieren können.
Gleichzeitig wird Sprache für Levi zur Rettung: Das Gespräch über Dantes „Gesang des Ulysses“ zeigt, wie Literatur und Sprache eine letzte Zuflucht für Levi bietet bietet.
c) Die physische und psychische Zerstörung
Die Gefangenen werden körperlich durch Hunger und Arbeit, aber auch psychisch durch den Verlust von Identität und moralischen Werten zerstört.
Die Nummer, die jedem Häftling zugewiesen wird, ist ein Symbol für den Verlust von Individualität.
d) Verantwortung und Zeugenschaft
Levi sieht es als seine moralische Pflicht, von seinen Erlebnissen zu berichten.
Er stellt die Frage, inwiefern die Menschheit aus diesen Ereignissen lernen kann und ob Gedenken allein ausreicht, um solche Gräueltaten zu verhindern.
Symbolik und Leitmotive
a) Die Frage „Ist das ein Mensch?“
Der Titel und das Eingangsgedicht stellen die zentrale Frage: Wann hört ein Mensch auf, Mensch zu sein?
Es geht nicht nur um die Opfer, sondern auch um die Täter und Mitläufer.
b) Die Nummer statt des Namens
Die Entmenschlichung beginnt mit der Zuweisung von Nummern.
Die Nummer symbolisiert den Verlust der Identität und den Versuch, den Menschen auf ein funktionales Objekt zu reduzieren.
c) Die kleinen Gesten des Widerstands
Waschen, aufrecht Gehen, Schuhe polieren – alltägliche Gesten, die zu Akten des Widerstands werden.
Sie symbolisieren die unzerstörbare Würde des Menschen.
Interpretationsansätze
a) Existenzialistische Perspektive
Levi zeigt, dass der Mensch selbst unter extremen Bedingungen noch Handlungsspielräume besitzt.
Der Akt des Widerstands, auch in kleinen Gesten, wird zum letzten Beweis menschlicher Freiheit.
b) Sprachkritischer Ansatz
Die Sprache wird sowohl als Instrument der Unterdrückung als auch als Mittel zur Befreiung dargestellt.
Levi macht deutlich, dass das Leid des Lagers eigentlich unaussprechlich ist und sich nur unvollständig in Worte fassen lässt.
c) Ethischer Ansatz
Levi stellt die Frage nach moralischer Schuld und Verantwortung.
Die Täter, Mitläufer und auch die Opfer stehen im Fokus ethischer Reflexionen.
d) Historischer Ansatz
Das Werk dient als zeitgeschichtliches Dokument, das die Lebensrealität in Auschwitz beschreibt.
Die Details der Zerstörung von Menschlichkeit geben Aufschluss darüber, wie totalitäre Systeme funktioniere
Rezension & Wertung
In 0-5 Lesezeichen 🔖wir das Werk in folgenden Punkten bewertet
Figurenbewertung
🔖🔖🔖🔖🔖 (5/5)
Primo Levis «Ist das ein Mensch?» erzählt keine fiktionale Geschichte, alle Figuren sind echte Menschen, die so mal gelebt haben.
Dadurch sind die Figuren unglaublich glaubwürdig. Die Veränderungen, die die Figuren durchmachen scheinen nachvollziehbar in Bezug auf die grausame Situation in den Konzentrationslagern. Der Verfall von einst normalen Menschen zu gebrochenen Menschen kann man sich einfach vorstellen.
Spannung, Verständlichkeit und Lesefluss
🔖🔖🔖🔖🔖 (5/5)
Die Spannung während des Buches wird durchgehend hochgehalten, Primo Levi ist in einer lebensgefährlichen Situation. Die lebensgefährliche Situation, bei der jeder Fehler zum Tod führen könnte, macht das Buch überaus spannend.
Ebenso ist das Buch sehr verständlich geschrieben, die Übersetzung aus dem Italienischen funktioniert super. Man sieht, dass Primo Levi viel Wert auf eine schöne Sprache gesetzt hat.
Das Buch lässt sich überaus flüssig lesen, zum einen wegen der schönen Sprache, andererseits wegen des linearen Aufbaus und der spannenden Geschichte.
Inspiration und persönliche Eindrücke
🔖🔖🔖🔖🔖 (5/5)
Ich persönlich kann das Wert an die allermeisten Menschen weiterempfehlen.
Es ist wichtig, sich mit der Vergangenheit und der Geschichte auseinanderzusetzen. Leider gehört zur Vergangenheit auch der Holokaust, eines der schlimmsten Verbrechen der Menschheit. Levi dabei zuzuhören, wie er über den Alltag im Konzentrationslager spricht, lässt uns ein wenig miterleben, wie sich die Menschen damals fühlten. Diese Eindrücke sind unvergesslich und jeder Mensch sollte darüber lesen und davon wissen. Was noch dazu kommt ist, dass das Werk gutgeschrieben ist, es macht Spass zu lesen.
Allgemeiner Eindruck
Das Buch erhält eine Gesamtwetung von 5/5 und ist aus genannten Gründen stark weiterzuempfehlen: «Ist das ein Mensch» bietet eine reale und subjektive Perspektive eines Holokaustopfers, mit allem, was dazu gehört.
Lesetipps
Ein Projekt von Samuel Hunak, Nils Hürlimann und Maurin Jenny im Rahmen des Fachunterrichts Deutsch an der Neuen Kantonsschule Aarau zur Inspiration und Hilfe bei der Bücherauswahl für Zukünftige Matura-Klassen
Kontakt & Anfragen
© Samuel Hunák, 2024. Alle Rechte vorbehalten.
